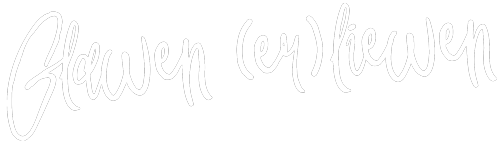Eine neue Karte für die Kirche

Foto: Lex Kleren
Interview: Dani Schumacher
Sind Sie froh, dass die neue Landkarte fertig ist?
Tom Kerger: Sehr froh! Es war ein langer, aber auch sehr spannender Prozess, der bis zum Schluss immer wieder Veränderungen mit sich brachte.
Gérard Kieffer: Es war ein partizipativer Prozess. Die Entscheidung, die Pfarreien neu zu ordnen, wurde im Bistum getroffen, auch die ersten Vorschläge wurden vom Bistum unterbreitet. Diese Vorschläge wurden dann den Pfarrgemeinden unterbreitet, wer wollte konnte seine Meinung einbringen und mit uns diskutieren. Wenn der Wunsch bestand, haben wir den Prozess begleitet. Die Mitglieder der Pfarreien konnten aber auch eigenständig arbeiten, wenn ihnen das lieber war.
Sie sprechen von einem Prozess, ist der Prozess friedlich verlaufen oder wurde auch manchmal gestritten?
G.K. Das eine schließt das andere nicht aus. Die Streitkultur ist in der Kirche vielleicht nicht so ausgeprägt, aber es war auch nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen (lacht). Wir waren allerdings vorbereitet. Der Erzbischof hatte die Kirchenmitgliedern in den neuen Pfarreien aufgefordert, in einem Zukunftsbrief auf drei Fragen zu antworten. Darin sollten sie ihm konkret mitteilen, was für sie vor Ort in Zukunft wichtig ist. Die Fragen dienten als Impuls, sie waren gewissermaßen der Startschuss für die Diskussionen. Für mich persönlich war es übrigens ein sehr positives Erlebnis, ich habe meine Kirche, für die ich schon mehr als 25 Jahre tätig bin, neu entdeckt, als ich durch die Pfarreien gefahren bin, um das Projekt zu begleiten. Die Pfarrer und die Mitglieder der Pastoralteams haben sich ganz ähnlich geäußert.

Foto: Lex Kleren
T.K. Dies gilt auch für die Menschen in den Pfarreien. Viele haben uns berichtet, dass es für sie eine richtige Entdeckungsreise war. Oft wussten sie nicht, was sich in den Nachbarpfarreien eigentlich tut. Durch den Prozess hat man sich kennengelernt, man hat sich ausgetauscht. Für die meisten, die mitgemacht und sich auf das Abenteuer eingelassen haben, war es meiner Meinung nach eine positive Erfahrung. Die Versammlungen waren übrigens durchwegs gut besucht.
Die Streitkultur ist in der Kirche vielleicht nicht so ausgeprägt, aber es war auch nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. »
Weshalb war die pastorale Reorganisation eigentlich erforderlich?
T.K.: Die Überlegung reicht länger zurück. Anfang des Jahrtausends wurden die 57 Pfarrverbände geschaffen. Dabei handelte es sich noch nicht um eine wirkliche eine Zusammenlegung, doch innerhalb der Pfarrverbände haben die Pfarreien bereits eng zusammengearbeitet. Die aktuelle Zusammenlegung ist also eine Weiterentwicklung dieses Prozesses.
G.K. Eine der Ursachen für die pastorale Reorganisation war natürlich die Personalfrage. Mit Personal meine ich sowohl die Geistlichen als auch die Laienmitarbeiter. Es ist natürlich auch eine Frage der Organisation. Es ist einfacher, die Pastorale in einem größeren Raum zu organisieren, als in vielen kleinen Pfarreien. Die Mobilität spielt eine wesentliche Rolle. Die Menschen bleiben nicht mehr in ihrem Dorf. Wenn wir in einem größeren Raum arbeiten, können wir das Angebot erweitern, weil einfach mehr Menschen da sind, die es in Anspruch nehmen. Nehmen Sie etwa die Jugendpastorale. Es macht keinen Sinn, wenn ich in jedem Dorf eine Handvoll Jugendliche betreue. Dann ist es besser, ich bündle meine Kräfte und biete ein besseres Angebot an einer Stelle. Es wird dadurch auch möglich sein, das Angebot zu diversifizieren. Es muss nicht mehr jeder alles machen.

Foto: Lex Kleren
T.K. Die großen Pfarreien ermöglichen es uns auch, die Verwaltung zusammenzulegen. Auch das spart Zeit und Arbeit.
Wieso sind es gerade 33 Pfarreien, war diese Zahl von Anfang an vorgegeben?
G.K. Nein, das war Zufall, das hat sich im Verlauf der Diskussionen so ergeben. Wenn sich herausstellte, dass in der Vergangenheit enge Verbindungen zwischen zwei alten Pfarreien bestanden, dann haben wir dem Rechnung getragen. Unser Ziel war es, den Menschen eine Basis zu geben, in der sie sich wiederfinden. Es gab aber ganz praktische Kriterien. Eine Voraussetzung war, dass die Grenzen der Zivilgemeinden respektiert werden mussten.

Foto. Bistum
Die neuen Pfarreien sind unterschiedlich groß. Ist beispielsweise die Pfarrei Notre-Dame in der Hauptstadt nicht doch etwas zu groß geraten?
T.K. Wie gesagt, die Grenzen tragen den Wünschen der Menschen Rechnung. In der Hauptstadt mit ihren 119 000 Einwohnern gehen die 19 alten und die Europa-Pfarrei in der neuen Pfarrei Notre-Dame auf. Die ist in der Tat recht groß. Arbeitstechnisch wird die Pfarrei deshalb in vier Bezirke aufgeteilt. Die ländlichen Pfarreien im Ösling sind von der Fläche her ebenfalls ziemlich groß, allerdings leben dort weit weniger Menschen. Differdingen ist hingegen klein, zählt aber 25.000 Einwohner. Die Einwohnerzahlen waren ein weiteres Kriterium bei der Reorganisation der pastoralen Landschaft.
Große Pfarreien bedeuten aber auch lange Wege. Befürchten Sie nicht, dass einige Gläubige den Weg in die Kirche nicht mehr finden werden?
G.K. Natürlich sind große Strukturen auch angstbesetzt. Die Leute haben Angst, dass die Kirche nicht mehr im Dorf bleibt. Dessen sind wir uns durchaus bewusst und wir nehmen die Sorgen der Menschen sehr ernst. Die Eigenverantwortung der Menschen spielt in Zukunft eine größere Rolle, die neuen Räume wollen erobert werden.
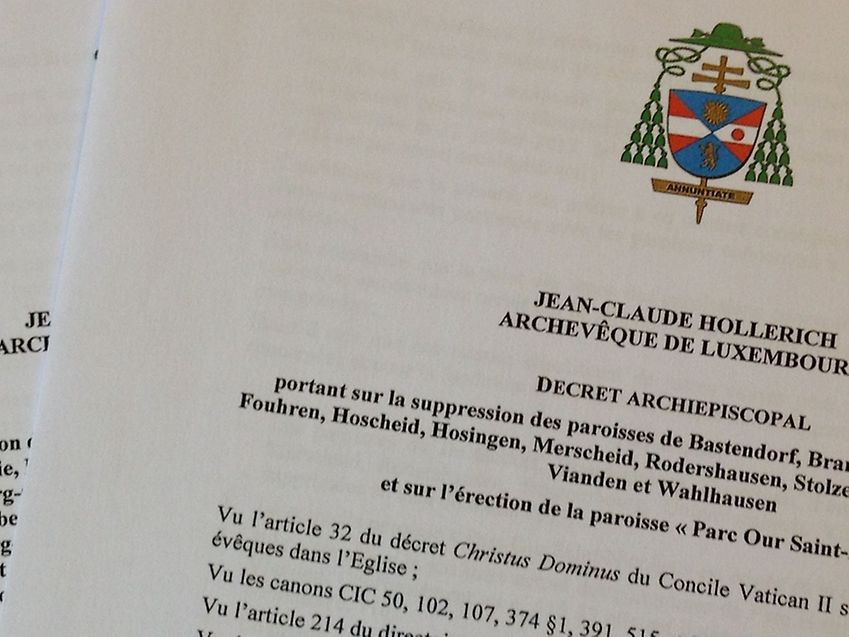
Foto: Dani Schumacher
Die Reorganisation stellt aber auch die Pfarrer vor neue Herausforderungen. Bislang waren sie in ihren jeweiligen Pfarreien eher auf sich gestellt nun müssen sie als Mannschaft zusammenarbeiten …
T.K. In den größeren Pfarreien, wo es mehrere Geistliche gibt, wird ein Pfarrer zum ‘curé modérateur’ ernannt. Er ist aber nicht der Chef, er ist derjenige, der das Team aus Pfarrern und Laienhelfern zusammenhält. Es geht weniger um die Hierarchie, als vielmehr um die Übersicht der Teamarbeit.
Wenn das Gesetz zum Kirchenfonds erst einmal in Kraft ist, werden die Pfarreien laut den Statuten des Fonds von den so genannten ‘Conseils de gestion paroissiaux’ verwaltet. Wie sieht dies in der Praxis genau aus?
T.K. Wenn es keine Kirchenfabriken mehr gibt, werden sich die neuen Pfarreien finanziell selbst verwalten, unter der Aufsicht des Bistums natürlich. Sie stellen ihren eigenen Haushalt auf und sie müssen sehen, dass sie mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zurecht kommen. Das war in der Vergangenheit nicht viel anders. Es wird in sofern einfacher, als es nur noch 33 statt wie bisher 274 Pfarreien gibt.
Mittlerweile liegt die Annexe III zum Fonds-Gesetz vor. Wurde bei der Auswahl der Kirchen, die auf dieser Liste stehen und die den Gemeinden gehören, der neuen Pfarrstruktur Rechnung getragen?
T.K. Selbstverständlich. Unser Ziel war es, dass es auch in Zukunft in jeder neuen Pfarrei mindestens eine große, zentrale Kirche gibt, die wir weiterhin benutzen können. Leider hat es nicht überall geklappt.
Es ist etwas in Gang gekommen, von dem das kirchliche Leben nur profitieren kann. »
Die territoriale Reorganisation ist abgeschlossen, mit der Abschaffung der Kirchenfabriken steht eine weitere Reform noch bevor. Geht die Kirche gestärkt aus dem ganzen Prozess hervor?
G.K. Ich bin der Meinung, dass die Kirche am Ende in der Tat besser aufgestellt sein wird. Allein schon wegen der vielen Diskussionen, die in den vergangenen Monaten geführt wurden. Es ist eine richtige Diskussions- und Austauschkultur entstanden, die es in der Form nie gegeben hat. Das gilt für die Neuordnung der Pastorale aber auch für die Debatte um die Kirchenfabriken.
T.K. Ich sehe das genau so. Es ist etwas in Gang gekommen, von dem das kirchliche Leben nur profitieren kann.